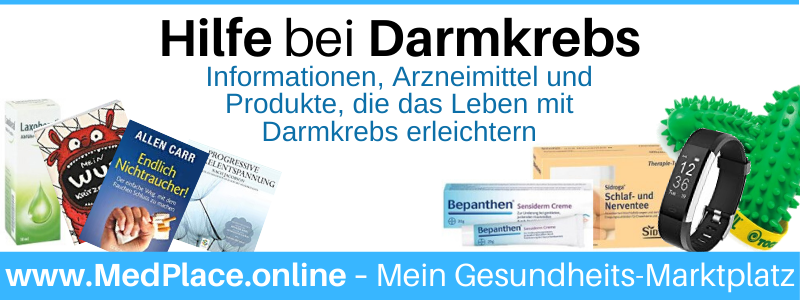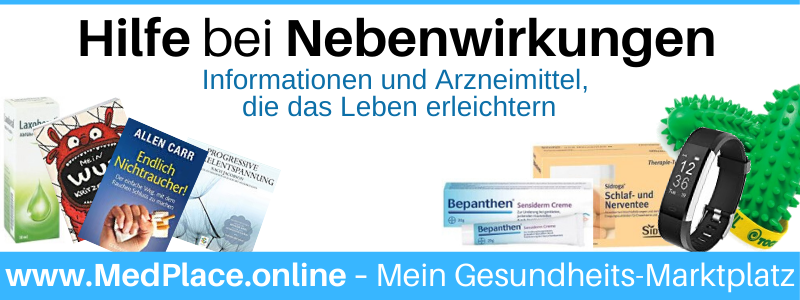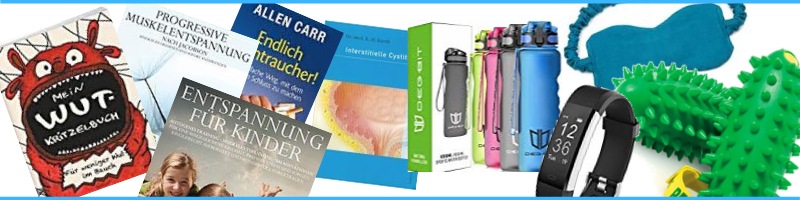Übersicht der Behandlungsmöglichkeiten
Aktuelle Studien- und Forschungsergebnisse
Die operative Entfernung des Tumors bei Darmkrebs kann mit Roboter-assistierter und laparoskopischer Kolektomie vergleichbare Ergebnisse liefern, zeigte ein systematischer Review mit Metaanalyse über 4 Studien. Es konnten keine signifikanten Unterschiede in den Komplikationsraten festgestellt werden.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Eine Metaanalyse über 14 Studien und 3 681 medizinschen Cannabis-Nutzern fand eine Prävalenz der Cannabiskonsumstörung von 25 % – vergleichbar hoch zu der bei regelmäßigen Freizeitkonsumenten.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Hier finden Sie aktuelles aus Forschung und Wissenschaft zu folgenden Themen:
Eine randomisiert-kontrollierte Studie mit 48 Teilnehmern fand, dass Metformin bei Patienten ohne vorherige Diabetes-Diagnose den Anteil der Patienten senken kann, die nach einer elektiven Darmkrebs-Operation eine postoperative Hyperglykämie entwickeln. Allerdings war die Teilnehmerzahl zu gering, um mögliche Unterschiede in der Komplikationsrate zu erkennen.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Die Einnahme von Vitamin C könnte das Risiko für Krebserkrankungen des Verdauungstrakts signifikant senken, zeigte ein systematischer Review mit Metaanalyse über 32 Studien. Dies umfasst Krebs von Mundhöhle, Rachen und Speiseröhre, Magenkrebs und Darmkrebs.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Eine aktuelle Metaanalyse legt nahe, dass sich der Einsatz von SGLT2-Inhibitoren bei Krebspatienten mit Diabetes positiv auf das Herz-Kreislaufsystem auswirkt. Insbesondere führte die Therapie mit SGLT2-Inhibitoren zu einer verringerten Mortalität und weniger Krankenhauseinweisungen aufgrund von Herzinsuffizienz.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Ein systematischer Review mit qualitativer Analyse über 6 Studien fand, dass Cannabinoide vielversprechend für Appetitsteigerung und Gewicht bei älteren Personen mit Anorexie und Krebserkrankungen sind. Größere Studien müssen das tatsächliche Potential sowie Risiken speziell in Bezug zu möglichen Wechselwirkungen mit Krebstherapien evaluieren.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Im systematischen Review mit Metaanalyse über 61 randomisiert-kontrollierte Studien ermittelten Wissenschaftler kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie als besten Behandlungsansatz für Schlafstörungen bei erwachsenen Krebsüberlebenden. Für Patienten in aktiver Krebsbehandlung schien eine Kurzform der Therapie vielversprechend gegen Schlafstörungen zu sein.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Nach einem systematischen Review mit Metaanalyse über 21 Studien mit zusammen 1 754 Patienten sollte die Wahl palliativer Behandlungen bei fortgeschrittenem, obstruktivem Darmkrebs individuell abhängig vom Zustand und Wünschen des Patienten getroffen werden. Die Implantation von SEMS erfolgte mit niedrigeren frühen Komplikationsraten, Stoma-Bildung, 30-Tage-Sterblichkeit und kürzeren Krankenhausaufenthalten. Eine Operation hatte hingegen größeren klinischen Erfolg und führte zu höheren Überlebensraten und weniger späten Komplikationen.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Eine Phase-III-Studie untersuchte Wirksamkeit und Sicherheit der vollständigen mesokolischen Exzision (CME) mit der konventionellen Darmkrebsoperation mit 258 randomisiert aufgeteilten Darmkrebspatienten. Es konnten keine signifikanten Unterschiede bezüglich intra- oder postoperativer Komplikationen, postoperativer Sterblichkeit oder Dauer der Operation gesehen werden. CME entfernte jedoch signifikant mehr Lymphknoten als die konventionelle OP. Auch war die Dauer des Krankenhausaufenthalts mit CME signifikant kürzer.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Eine Metaanalyse zeigte weniger Komplikationen ab Grad 3 und weniger Blutverlust mit kompletter mesokolischer Exzision (CME) bei Darmkrebs als mit Standardresektion. Auch war die durchschnittliche Lymphknotenentnahme mit CME höher. Zwischen roboterassistierter und laparoskopischer CME ergaben sich hingegen keine signifikanten Unterschiede.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Eine prospektive Beobachtungsstudie analysierte potentielle Einflussfaktoren auf den Schweregrad von Neuropathie im Zusammenhang mit oxaliplatinbasierter Chemotherapie bei Patienten mit Darmkrebs im Stadium III. Eine längere Behandlungsdauer (12 versus sechs Zyklen), geringe körperliche Aktivität, hoher BMI und Diabetes waren mit stärkerer Neuropathie assoziiert. Die Einnahme von Celecoxib oder Vitamin B6 hatte keine Besserung zur Folge.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Eine Phase-III-Studie ermittelte, ob eine neoadjuvante Chemotherapie (CAPOX) statt der üblichen Radiochemotherapie bei lokal fortgeschrittenem Enddarmkrebs eingesetzt werden kann. Pathologische Ansprechrate und Downstaging-Rate waren vergleichbar, Chemotherapie allein war jedoch mit geringerem Risiko für perioperative Metastasen, postoperative Komplikationen und Notwendigkeit eines präventiven künstlichen Darmausgangs verbunden.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Eine randomisierte Phase-II-Studie zeigte vergleichbare Wirksamkeit von Panitumumab in Kombination mit zwei unterschiedlichen Chemotherapieregimen als Erstlinientherapie bei älteren Patienten mit metastasiertem Darmkrebs. Die Kombination aus Panitumumab und Monochemotherapie hatte jedoch ein vorteilhafteres Sicherheitsprofil.
Weiter zum ausführlichen Bericht →