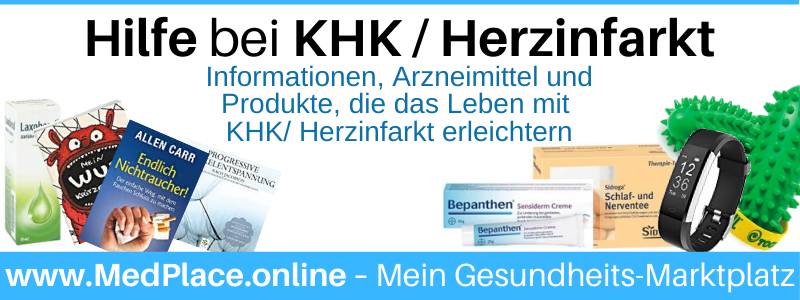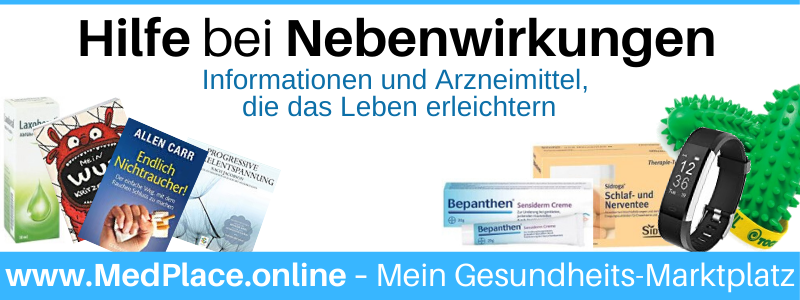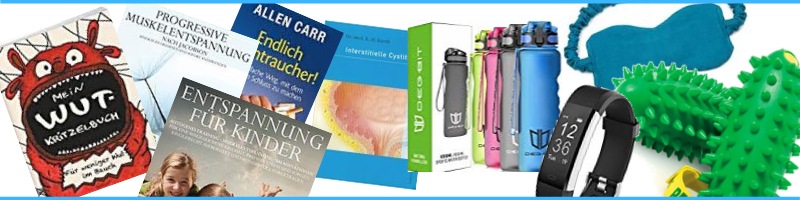Übersicht der Behandlungsmöglichkeiten
Aktuelle Studien- und Forschungsergebnisse
Statine haben sich bereits darin bewährt, das Risiko für Folgeerkrankungen der koronaren Herzkrankheit (KHK) zu reduzieren. Diesen positiven Effekt vermitteln die Statine, indem sie das Cholesterin senken. Cholesterin ist nämlich an der Bildung der Ablagerungen (Plaques) in den Gefäßwänden, das typische Krankheitsbild der KHK, beteiligt. Obwohl die positive Wirkung der Statine bereits in mehreren Studien belegt werden konnte, ist nur wenig darüber bekannt, ob der schützende Effekt auch bei älteren Patienten, die ein Risiko für eine Mangelernährung aufweisen, gegeben ist. Genau mit diesem Thema beschäftigte sich ein Forscherteam aus Sichuan (China).
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Eine Post-hoc-Analyse von Daten der randomisierten SPRINT-Studie untersuchte den Einfluss depressiver Symptome auf klinische Verläufe bei Menschen mit Bluthochdruck. Depressive Symptome waren signifikant mit schlechteren Verläufen, Gesamtmortalität und Herzerkrankungen verbunden.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Hier finden Sie aktuelles aus Forschung und Wissenschaft zu folgenden Themen:
In der europäischen EPIC-CVD-Fall-Kohortenstudie wurde der Zusammenhang zwischen dem Verzehr von pflanzlichem oder tierischem Protein und dem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) untersucht.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Sollte eine orale Antikoagulation nach Vorhofflimmern-Katheterablation fortgeführt werden? In einer aktuellen Studie war die fortgesetzte OAK-Therapie über 6 Monate je nach CHADS2-Score mit mehr Vorteilen, einem geringeren Risiko für Thromboembolie, oder mehr Nachteilen, wie dem Risiko für schwere Blutungen, assoziiert.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Neuere Studienergebnisse deuten darauf hin, dass Lakritz mit dem Inhaltsstoff Glycyrrhizinsäure (GA) eine stärkere Wirkung auf den Blutdruck hat als bisher angenommen. Bereits eine tägliche Einnahme von 14 – 15 Lakritzpastillen, entsprechend dem WHO-Grenzwert von 100 mg GA, erhöhte Blutdruck und Biomarker für Herzinsuffizienz bei jungen, gesunden Probanden.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Aktuelle Studienergebnisse deuten auf einen kausalen Zusammenhang zwischen einer genetischen Veranlagung zu Menstruationsbeschwerden und unregelmäßigem Zyklus und Herz-Kreislauf-Erkrankungen hin.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Eine aktuelle Studie hat sich mit der Telomerlänge als Biomarker für Typ-2-Diabetes bei Menschen mit koronarer Herzkrankheit auseinandergesetzt. Zudem wurde der Nutzen von Ernährungstherapien zur Prävention von Typ-2-Diabetes bei Menschen mit koronarer Herzkrankheit evaluiert.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Australische Wissenschaftler konnten im Rahmen eines systematischen Reviews ein erhöhtes Risiko für ein akutes Koronarsyndrom bei Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen aufzeigen. Dieser Zusammenhang war besonders bei jüngeren Erwachsenen unter 40 Jahren zu beobachten.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Neuere Forschungsdaten lassen darauf schließen, dass die Behandlung von Typ-2-Diabetes mit GLP-1-Rezeptoragonisten im Vergleich zur Behandlung mit DPP4-Inhibitoren und Basalinsulin zu einer Verbesserung der kardiovaskulären Gesamt- und Einzelergebnisse führen könnte.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Bei Menschen mit vorbestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht/Adipositas konnte das Diabetesmedikament Semaglutid in einer aktuellen Placebo-kontrollierten Studie das kardiovaskuläre Risiko senken. Die insgesamt 17 604 Probanden hatten keinen Diabetes.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Bei Patienten mit chronischen Schmerzen ist die Anwendung von medizinischem Cannabis mit erhöhtem Risiko für neu einsetzende Arrhythmien assoziiert, speziell innerhalb von 180 Tagen nach Behandlungsbeginn, zeigte eine Registerstudie aus Dänemark.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Regelmäßiges Saunabaden konnte in einer aktuellen Studie die Gefäßgesundheit von Erwachsenen mit stabiler koronarer Herzkrankheit nicht signifikant verbessern. Allerdings verbesserte sich die Fähigkeit zur Hitzeakklimatisierung bei den Probanden.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Wissenschaftler verglichen in China Patienten, die nach milder bis mittelschwerer Infektion mit der Omikron-Variante des neuen Coronavirus eine Arrhythmie entwickelten, mit Patienten ohne diese Komplikation. Die Studie zeigte verschiedene Faktoren auf, die eine Arrhythmie nach Coronavirus-Infektion begünstigen können, wie Adipositas (BMI ≥ 24 kg/m2), schnelle Herzrate (≥ 100 Schläge/min) und mittelschwere (statt milde) Krankheitsschwere. Zudem deuten mehrere Blutwerte, höheres Alter und eine Vorgeschichte mit Arrhythmien auf einen womöglich ungünstigeren Verlauf einer Arrhythmie nach COVID-19.
Weiter zum ausführlichen Bericht →